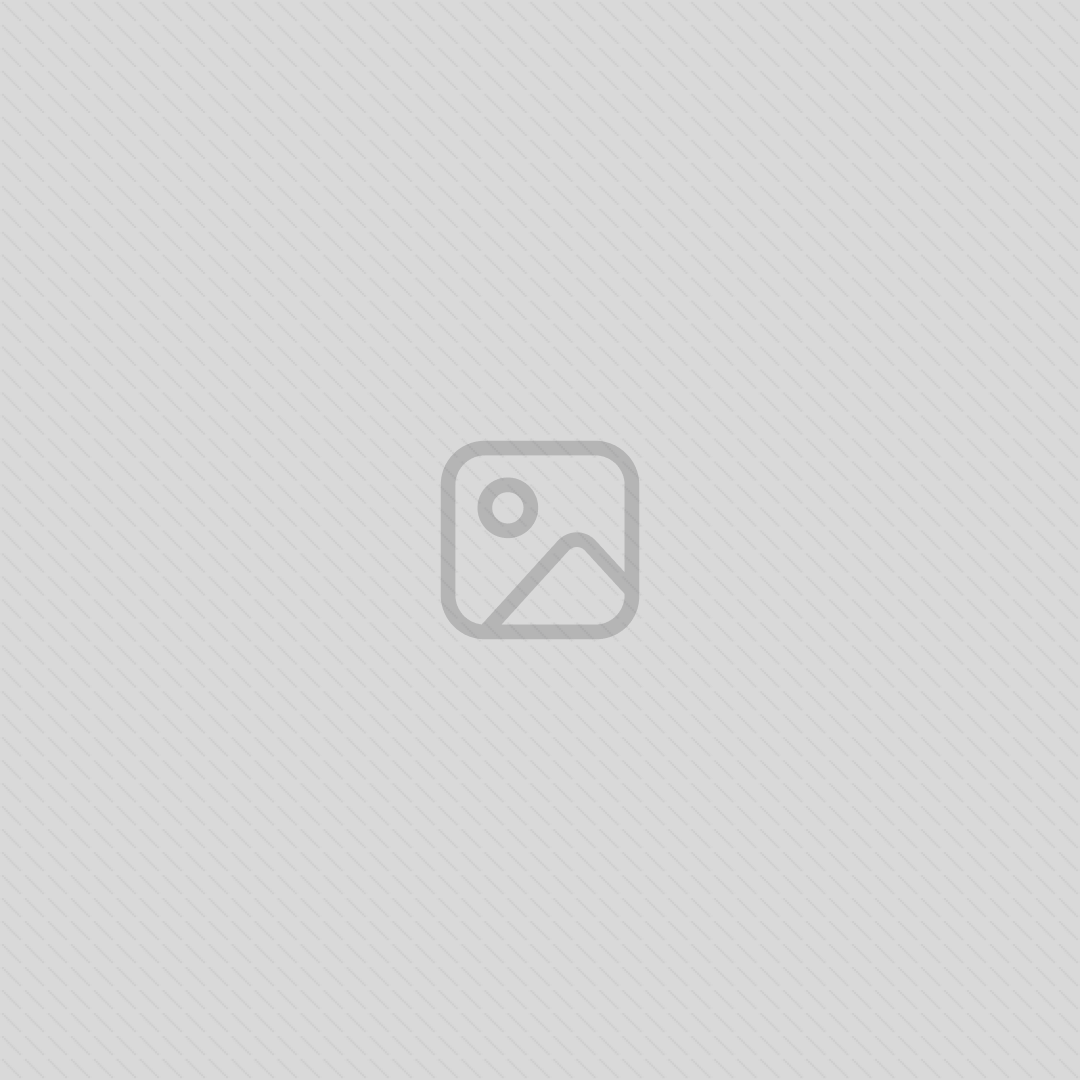Verstehen von Hörbeeinträchtigungen und Cochlea-Implantaten
Für normal hörende Menschen ist es oft schwer vorstellbar, was es bedeutet, mit einer Hörbeeinträchtigung zu leben oder auf ein Cochlea-Implantat angewiesen zu sein. Diese mangelnde Kenntnis führt häufig zu Missverständnissen über die tatsächlichen Herausforderungen und Bedürfnisse von Betroffenen. Ein tieferes Verständnis der medizinischen und technischen Grundlagen ist daher unerlässlich, um angemessene digitale Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Hörbeeinträchtigungen können verschiedene Ursachen haben. „Bei den Patient*innen handelt es sich meistens um taub oder extrem schwerhörig geborene Kinder, die mithilfe eines konventionellen Hörgeräts nicht die Möglichkeit haben, sprechen zu lernen. Die zweite Indikation betrifft Menschen, bei denen die ursprünglich vorhandene Hörfähigkeit durch verschiedene Schädigungen des Innenohrs verloren gegangen ist“, wie Dr. Christoph Balber vom Ordensklinikum Linz erklärt. Die Auswirkungen gehen dabei weit über das reine Nichthören hinaus: „Hörverlust beeinträchtigt das Leben wesentlich und ist als gesundheitlicher Risikofaktor bekannt; Er verkürzt sogar die Lebenserwartung Betroffener“.
Das Cochlea-Implantat stellt eine technologische Revolution dar. „Als aktive Innenohrprothese übernimmt das Cochlea-Implantat die Funktion der Hörschnecke des Innenohres. Während ein normales Hörgerät nur den Schall verstärkt, um so die Sprache für den Schwerhörigen verständlich zu machen, wandelt das Cochlea-Implantat den Schall in elektrische Impulse um“, wie die MEDICLIN Bosenberg Kliniken erläutern. Diese Impulse leitet das Hörimplantat dem Hörnerv in einem bestimmten Muster zu, das beispielsweise einem gesprochenen Wort entspricht.
Die Realität nach der Implantation ist jedoch komplexer, als viele annehmen. „Das Implantat bringt viele Vorteile, es ist jedoch kein Wundermittel. Patient*innen benötigen nach der OP ein gewisses Maß an Übung und Training, um optimale Ergebnisse zu erzielen“, betont Dr. Balber: „Man darf keine falschen Erwartungen wecken: das Hören mit Implantat ist nicht dasselbe wie es ein hörgesunder Mensch gewohnt ist“. Die Anpassungsphase kann erheblich sein: „Nach einem halben bis einem Jahr Hörtraining gelingt es Trägerinnen und Trägern eines Cochlea-Implantats ganz gut, in einer ruhigen Umgebung Sprache zu verstehen“, erklärt Prof. Tobias Moser vom Projekt „OptoHear“.
Besonders bei Kindern ist der Lernprozess intensiv und langwierig. „Ist ein Kind von Geburt an taub oder stark schwerhörig, sollte bereits um den ersten Geburtstag ein Cochlea-Implantat eingesetzt werden, da sich das Gehirn zu dieser Zeit noch entwickelt. Bei entsprechender Förderung haben diese Kinder dann annähernd die gleiche sprachliche Entwicklung wie hörgesunde Kinder und können meistens Regelschulen besuchen“, erklärt Dr. Balber. Doch der Weg dorthin erfordert intensive Unterstützung und Geduld aller Beteiligten.
Die technischen Limitationen aktueller Cochlea-Implantate sind erheblich. „Menschen mit intaktem Gehör können etwa 2000 unterschiedliche Tonhöhen auflösen. Jetzige Cochlea-Implantate verfügen aber nur über 12 bis 24 Stimulationskanäle, deren elektrische Reize sich in der Salzlösung der Hörschnecke sehr weit ausbreiten“, erläutert Prof. Moser. Diese technische Begrenzung hat direkte Auswirkungen auf die Qualität des Hörens und macht deutlich, warum digitale Inhalte verschiedene Zugangswege bieten müssen.
Die österreichische Ausgangslage
In Österreich leben 1,7 Millionen Hörbeeinträchtigte, wobei etwa 8.000 gehörlose Personen existieren, von denen 2.000 cochlea-implantiert sind. Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz barrierefreier digitaler Angebote für eine bedeutende gesellschaftliche Gruppe. Jährlich werden ca. 400 CI-Operationen durchgeführt, was die kontinuierlich wachsende Zielgruppe unterstreicht. Die medizinische Versorgung ist dabei in Österreich umfassend gewährleistet: „Die Kosten werden aus den Länderbudgets komplett von den Krankenhäusern übernommen“.
Die österreichische Cochlea-Implantat-Landschaft wird maßgeblich geprägt durch die Innsbrucker Firma MED-EL, die als einer der weltweiten Technologieführer gilt. „Pionierarbeit zur einsatzfähigen Entwicklung des Gerätekonzepts leisteten ab den 1960er Jahren William F. House in den USA, Graeme Clark in Australien und das Ehepaar Ingeborg und Erwin Hochmair in Österreich“. „1977 leistete unsere Geschäftsführerin Dr. Ingeborg Hochmair gemeinsam mit ihrem Mann Erwin Hochmair Pionierarbeit in der Entwicklung des ersten modernen Cochlea-Implantats“, wie MED-EL auf ihrer Website dokumentiert. Diese historische Bedeutung Österreichs in der Cochlea-Implantat-Technologie unterstreicht die Notwendigkeit, auch bei der digitalen Barrierefreiheit eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich
Die digitale Barrierefreiheit ist in Österreich umfassend gesetzlich geregelt. „Das Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG), das am 23. Juli 2019 in Kraft getreten ist (BGBl. I Nr. 59/2019) regelt neben den Anforderungen an die Barrierefreiheit für die Webseiten und mobilen Anwendungen des Bundes auch Maßnahmen wie das Berichts- und Dokumentationswesen und die Überprüfung der Einhaltung der Standards“.
Für private Unternehmen wird die Situation ab 2025 verschärft: „Am 28. Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) in Kraft, welches private Wirtschaftsakteure, die gewisse Produkte oder Dienstleistungen anbieten, verpflichtet, Barrierefreiheitsanforderungen zu beachten“. Diese rechtlichen Entwicklungen schaffen einen verbindlichen Rahmen, der insbesondere für Cochlea-Implantat-Träger:innen von hoher Relevanz ist. „Eine Ausnahme bilden Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Millionen Euro“.
Spezifische Herausforderungen für Cochlea-Implantat-Träger:innen
Cochlea-Implantate funktionieren grundlegend anders als natürliches Hören. „Hörgeräte verstärken meistens nur die Lautstärke von Geräuschen und Tönen. Cochlea-Implantate funktionieren anders: sie umgehen den geschädigten Teil des Ohres und stimulieren den Hörnerv direkt“, wie Cochlear auf ihrer Website erklärt. Diese technische Funktionsweise führt zu spezifischen Herausforderungen im digitalen Raum, die bei der Gestaltung barrierefreier Websites berücksichtigt werden müssen.
Das Hören mit Cochlea-Implantaten unterscheidet sich qualitativ vom natürlichen Hören. „Manche Menschen hören Pieptöne oder andere unbekannte Geräusche. Andere können sofort Sprache verstehen. Im Laufe der Zeit und durch regelmäßiges Hörtraining wird der Klang natürlicher und das Hören besser“, beschreibt MED-EL die Hörerfahrung. Diese Variabilität in der Hörerfahrung macht deutlich, warum digitale Inhalte verschiedene Zugangswege bieten müssen.
Die begrenzte Auflösung aktueller Cochlea-Implantate stellt eine besondere Herausforderung dar. „So können die Nervenfasern in der Hörschnecke nicht getrennt angestoßen werden, sondern immer ganz viele auf einmal. Die Trägerinnen und Träger der Implantate können entsprechend Tonhöhen schlecht auseinanderhalten, sodass sie Sprache schlechter verstehen und oft auch weniger Freude an Musik haben“, erläutert Prof. Moser. Diese technische Begrenzung hat direkte Auswirkungen auf die Verarbeitung auditiver Inhalte im Internet und macht zusätzliche Informationskanäle erforderlich.
Praktische Umsetzung der Webzugänglichkeit
Für die praktische Umsetzung barrierefreier Websites sind mehrere Aspekte von zentraler Bedeutung. „Videos ohne Untertitel: Alle Videos brauchen Untertitel für Gehörlose und Audiodeskriptionen für Blinde“, wie die Experten von Heise RegioConcept betonen. Diese Anforderung ist für Cochlea-Implantat-Träger:innen besonders relevant, da die Qualität der Audiowahrnehmung stark variieren kann.
Die Bedeutung von Untertiteln geht dabei über die reine Textdarstellung hinaus. „Menschen mit Hörbeeinträchtigung können Videos und Audio-Inhalte nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen. Sie brauchen alternative Textformate wie Transkripte oder Untertitel, um die Informationen zu verstehen“, erklärt IT4MED in ihrem Leitfaden für Ärzte. Für Cochlea-Implantat-Träger:innen können Untertitel auch dann hilfreich sein, wenn sie grundsätzlich Sprache verstehen können, da sie zusätzliche Sicherheit und Verständnishilfe bieten.
Die technischen Anforderungen orientieren sich an den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). „Es gibt klar definierte Barrierefreiheitskriterien. Das sind die WCAG und eine Reihe an zusätzlichen Kriterien“, wie auf der österreichischen Plattform digitalbarrierefrei.at dokumentiert ist. Diese Standards umfassen vier Grundprinzipien: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit, die alle für Cochlea-Implantat-Träger:innen von Bedeutung sind.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Innovation
Die österreichische Cochlea-Implantat-Forschung zeigt beispielhaft, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit Innovation vorantreibt. „Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Österreichische Wissenschaftsfonds (FWF) fördern das vielversprechende Vorhaben zur Weiterentwicklung von Cochlea-Implantaten“, berichtet die Medizinische Universität Innsbruck. Diese Ansätze sollten auch bei der Entwicklung digitaler Barrierefreiheit Anwendung finden.
Die Zusammenarbeit zwischen Technologieentwicklung und Nutzererfahrung ist dabei essentiell. „MED-ELs fortwährende Innovationen basieren auf der engen interdisziplinären Zusammenarbeit von hochqualifizierten Forschern und Entwicklern verschiedener Disziplinen sowie auf der Beteiligung an zahlreichen wissenschaftlichen EU-Programmen und Projektkooperationen mit über 100 Forschungseinrichtungen weltweit“, dokumentiert Cochlea Implantat Austria. Ein ähnlich vernetzter Ansatz wäre für die Entwicklung optimaler digitaler Zugänglichkeit wünschenswert.
Gesellschaftliche und wirtschaftliche Dimensionen
Die Bedeutung der Webzugänglichkeit erstreckt sich über technische Aspekte hinaus. „Barrierefreiheit und Suchmaschinenoptimierung gehen Hand in Hand. Viele Maßnahmen, die Websites für Menschen mit Behinderungen besser nutzbar machen, helfen auch dabei, in den Suchergebnissen weiter oben zu landen“, konstatiert Heise RegioConcept. Diese Synergien machen deutlich, dass Barrierefreiheit nicht nur ethisch geboten, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist.
Die gesellschaftliche Teilhabe von Cochlea-Implantat-Träger:innen hängt maßgeblich von der Qualität der verfügbaren digitalen Infrastruktur ab. „Damit ermöglichen wir unseren Patienten die Integration in die Gesellschaft“, wie es im Cochlea-Implant-Zentrum Salzburg formuliert wird. Diese Integration kann nur gelingen, wenn auch die digitale Welt entsprechend gestaltet ist.
Zukunftsperspektiven und Empfehlungen
Die technologische Entwicklung von Cochlea-Implantaten schreitet kontinuierlich voran. „Die Cochlea-Implantate der Zukunft könnten sehr viel genauer arbeiten, indem sie Nervenzellen mit Licht statt Strom stimulieren“, erklärt Prof. Moser vom Projekt „OptoHear“. Diese Fortschritte werden möglicherweise auch neue Anforderungen an die digitale Barrierefreiheit stellen.
Für eine erfolgreiche Umsetzung der Webzugänglichkeit in Österreich sind mehrere Maßnahmen erforderlich. Erstens sollten Unternehmen und öffentliche Einrichtungen proaktiv Barrierefreiheitsstandards implementieren, auch wenn sie nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind. Zweitens ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Technologieentwicklern, Cochlea-Implantat-Träger:innen und Barrierefreiheitsexpert:innen notwendig. Drittens müssen Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen verstärkt werden, um das Bewusstsein für die spezifischen Bedürfnisse von Cochlea-Implantat-Träger:innen zu schaffen.
Fazit
Die Webzugänglichkeit für Cochlea-Implantat-Träger:innen stellt eine komplexe Herausforderung dar, die technische, rechtliche und gesellschaftliche Dimensionen umfasst. Das Verständnis für die besonderen Herausforderungen beim Erlernen des Hörens mit Cochlea-Implantaten ist dabei fundamental für die Gestaltung angemessener digitaler Lösungen. Österreich ist durch seine führende Rolle in der Cochlea-Implantat-Technologie und die fortschrittliche Gesetzgebung zur digitalen Barrierefreiheit gut positioniert, um auch in diesem Bereich Maßstäbe zu setzen. Die erfolgreiche Umsetzung erfordert jedoch eine koordinierte Anstrengung aller beteiligten Akteure und ein tiefgreifendes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse dieser Zielgruppe. Nur durch eine umfassende und nuancierte Herangehensweise kann sichergestellt werden, dass die digitale Welt für alle Menschen zugänglich und nutzbar wird.