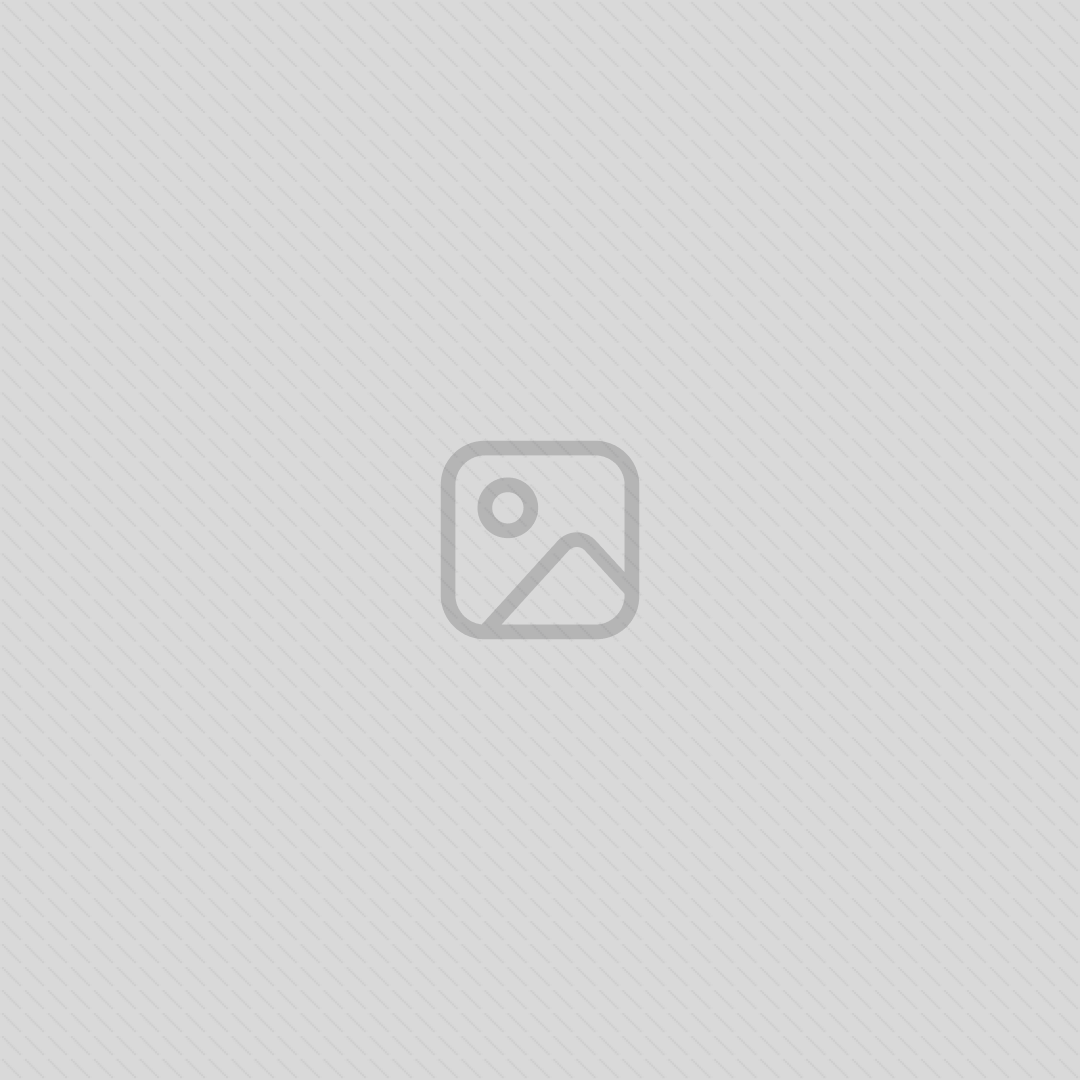Fragen des Designs versus Anliegen der Barrierefreiheit
Viele Websites der vergangenen Jahre folgten einem bewährten Muster: Ein ansprechendes Design wurde zum obersten Ziel erklärt. Große Bilder, aufwendige Animationen und visuelle Effekte sollten Besucher beeindrucken. Dieser Ansatz funktionierte, solange man nur an Menschen dachte, die Websites genauso wahrnehmen wie ihre Gestalter.
Doch diese Sichtweise greift zu kurz: Sie vergisst, dass Menschen sehr unterschiedlich sind. Manche können schlecht sehen, andere haben Schwierigkeiten mit der Mausbedienung, wieder andere können sich schwer konzentrieren. In Österreich leben viele Menschen mit Beeinträchtigungen. Für sie können sich so manche „schöne“ Websites als Hindernis darstellen.
Eine Website kann noch so eindrucksvoll aussehen – wenn sie nicht von allen genutzt werden kann, verfehlt sie ihren Zweck. Stellen Sie sich vor, Sie entwerfen einen wunderschönen Laden, aber die Eingangstür ist so schmal, dass Menschen mit Rollstuhl nicht hineinkommen. Genau das passiert oft im Internet.
Mit dem neuen österreichischen Barrierefreiheitsgesetz, das seit Juni 2025 gilt, wird diese Erkenntnis auch rechtlich verankert. Viele Unternehmen müssen ihre digitalen Angebote so gestalten, dass sie für alle Menschen zugänglich sind. Plötzlich reicht Schönheit allein nicht mehr aus.
Wendepunkte
Begegnungen mit blinden und kognitiv beeinträchtigten Menschen verändern unser Denken. Für sie sollten Websites ähnlich funktional wie ein öffentliches Gebäude sein, das für alle Menschen zugänglich ist.
Anstatt nur zu fragen „Wie sieht eine Website aus?“, sollten wir lernen zu fragen: „Wie funktioniert eine Website für jemanden, der/ die die Website nicht sehen kann? Wie bedient jemand die Website, der/ die keine Maus verwenden kann? Verstehen auch Menschen mit Lernschwierigkeiten die Inhalte einer Website? Wie müssen Dokumente unter einer Website gestaltet sein, damit sie auch von beeinträchtigten Menschen erfasst werden.“
Zugänglichkeit verändert Websites auf positive Weise
Websites, die für alle Menschen funktionieren, erwiesen sich anderen Websites gegenüber bereits aufgrund ihrer semantischen Struktur technisch überlegen. Sie laden schneller, funktionieren zuverlässiger und werden von Suchmaschinen besser gefunden. Dies zeigen beispielsweise die Messwerte der vorliegenden Website deutlich: Ladezeiten von nur 255 Millisekunden gehen mit stimmigen Barrierefreiheitswerten einher.
Diese Verbesserung ist kein Zufall. Wenn man eine Website so baut, dass sie auch für Menschen mit Beeinträchtigungen funktioniert, muss man klarer strukturieren, überflüssige Elemente weglassen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das Ergebnis sind schlankere, schnellere und benutzerfreundlichere Websites für alle.
Umdenken im Zuge von Barriefreiheitsanliegen
Der Wandel erfordert ein fundamentales Umdenken. Anstatt zuerst das Design zu entwerfen und später zu überlegen, wie eine Website funktioniert, muss deren Funktion von Anfang an mitgedacht werden.
Der Wandel muss nicht kompliziert sein. Beginnen kann man mit einfachen Fragen:
- Kann jemand diese Website verstehen, ohne die Bilder zu sehen?
- Funktioniert alles auch ohne Maus, nur mit der Tastatur?
- Sind die Texte auch für Menschen mit Leseschwierigkeiten verständlich?
- Laden die Seiten schnell genug für Menschen mit langsamem Internet?
Diese Fragen zu stellen und ehrlich zu beantworten ist ein erster Schritt. Die technischen Lösungen hierfür sind heute einfacher verfügbar als je zuvor.
Zum gesellschaftlichen Wandel
Die Forderung nach Barrierefreiheit ist mehr als ein technischer Wandel – es ist ein gesellschaftlicher. Wir leben in einer Zeit, in der digitale Teilhabe über reale Teilhabe entscheidet. Wer online nicht mithalten kann, bleibt auch im echten Leben außen vor.
Menschen mit Beeinträchtigungen haben das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe – auch im digitalen Raum. Letztendlich profitieren alle von Websites, die durchdacht, schnell und benutzerfreundlich sind.
Wirtschaftliche Vernunft trifft auf menschliche Werte
Der Wandel zu zugänglicheren Websites ist nicht nur ethisch berechtigt, sondern auch wirtschaftlich vernünftig. Menschen mit Beeinträchtigungen und ihre Familien bilden eine kaufkräftige Zielgruppe, die oft übersehen wird. Unternehmen, die diese Gruppe ernst nehmen, erschließen neue Märkte.
Gleichzeitig verbessern sich die technischen Eigenschaften der Websites: bessere Suchmaschinen-Platzierungen, schnellere Ladezeiten, geringere Wartungskosten. Was als sozialer Auftrag beginnt, entpuppt sich auch als geschäftlicher Vorteil.
Die Zukunft ist inklusiv
Der beschriebene Wandel von der reinen Optik zur durchdachten Funktionalität ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit. Websites der Zukunft werden daran gemessen, wie gut sie für alle Menschen funktionieren, nicht nur daran, wie beeindruckend sie aussehen.
Das bedeutet nicht das Ende ästhetischer Websites, sondern den Beginn intelligenter Websites. Schönheit und Funktionalität schließen sich nicht aus – im Gegenteil, sie ergänzen sich perfekt, wenn man von Anfang an richtig plant.
Jeder kleine Schritt in diese Richtung macht das Internet zu einem besseren Ort für alle. Am Ende profitieren alle davon: Menschen mit Beeinträchtigungen, die endlich gleichberechtigt teilhaben können, und alle anderen, die einfach nur eine gut funktionierende Website nutzen wollen.
Der Wandel hat bereits begonnen. Die Frage ist nicht, ob er kommt, sondern wie schnell wir bereit sind, ihn mitzugehen.