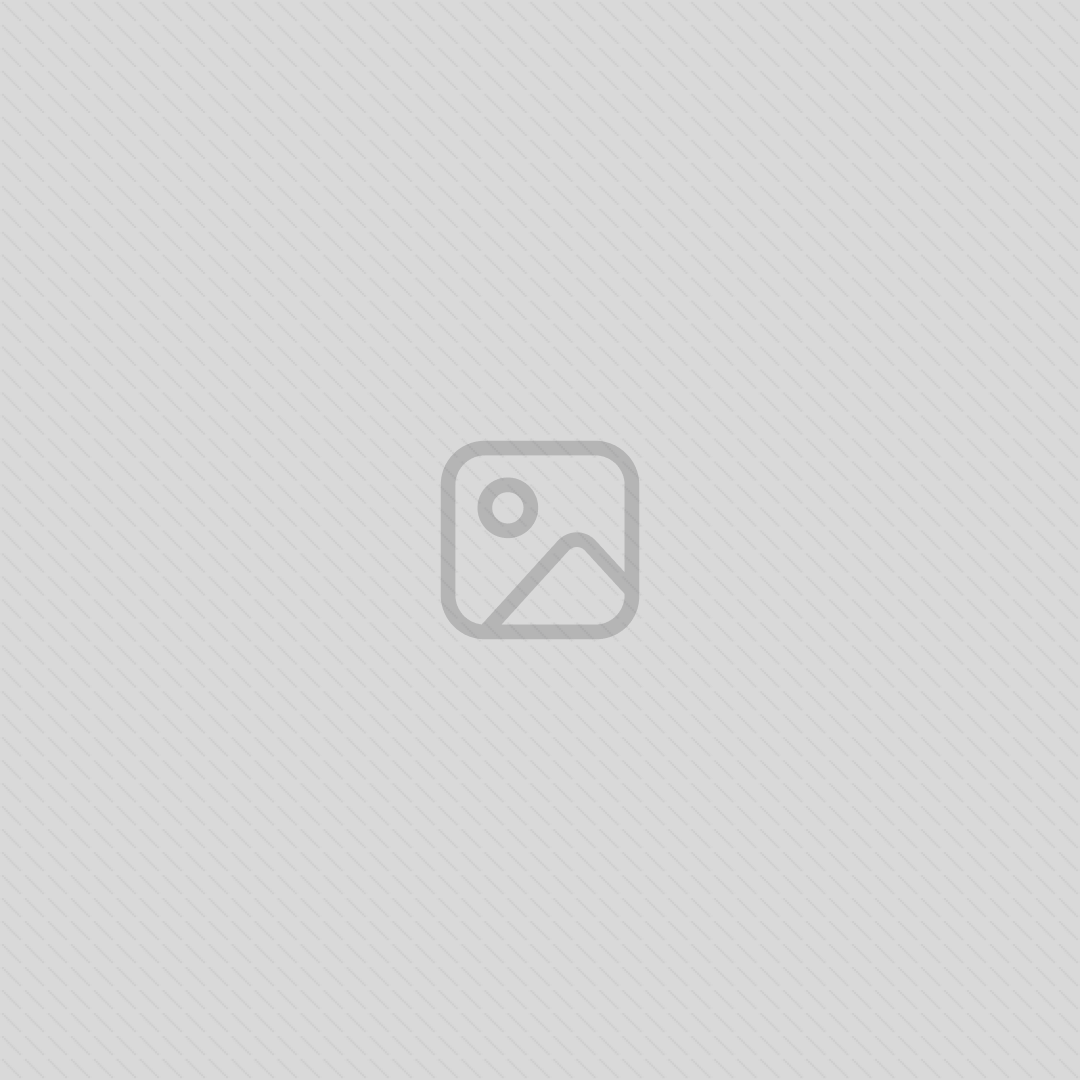Zwei Konzepte, ein Ziel – aber wichtige Unterschiede in der Umsetzung aus österreichischer Sicht
Die Rolle der Sprache in der digitalen Kommunikation hat in Österreich durch das Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG) von 2019 und das seit Juni 2025 geltende Barrierefreiheitsgesetz eine neue rechtliche Dimension erhalten. Diese Gesetzgebung macht deutlich, dass verständliche Kommunikation nicht nur eine ethische Verpflichtung, sondern auch eine rechtliche Notwendigkeit darstellt. Zwei Konzepte haben sich dabei etabliert: Einfache Sprache und Leichte Sprache. Beide verfolgen das Ziel der Verständlichkeit, unterscheiden sich jedoch fundamental in ihrer Anwendung, Zielgruppe und Umsetzung.
Theoretische Fundierung und Definition
Die konzeptionelle Unterscheidung zwischen Einfacher und Leichter Sprache basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Linguistik und Kommunikationsforschung. Capito, als österreichischer Marktführer für barrierefreie Information, definiert diese Unterscheidung anhand des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Einfache Sprache entspricht der Sprachstufe B1 und orientiert sich an der Alltags- oder Umgangssprache, während Leichte Sprache auf den Sprachstufen A1 bis A2 angesiedelt ist und strengeren Regeln folgt, die gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt wurden.
Diese Differenzierung ist nicht nur akademischer Natur, sondern hat praktische Auswirkungen auf die Gestaltung digitaler Kommunikation in Österreich. Das österreichische Parlament demonstriert diese Unterscheidung exemplarisch durch sein zweistufiges Angebot: Texte der Sprachstufe B1 für aktuelle politische Themen und Texte der Sprachstufe A2 für grundlegende Begriffe der politischen Bildung.
Zielgruppenorientierte Ansätze
Die Zielgruppenorientierung stellt den entscheidenden Unterschied zwischen beiden Konzepten dar. Einfache Sprache richtet sich an eine heterogene Gruppe: Menschen mit geringer Bildung, Nicht-Muttersprachler, Personen mit Lese- und Rechtschreibschwächen sowie alle, die sich rasch informieren möchten. Diese breite Zielgruppe macht Einfache Sprache zu einem wirksamen Instrument für die allgemeine Bürgerkommunikation, wie das Beispiel des ORF mit seinen „Nachrichten in Einfacher Sprache“ zeigt, die 2021 2,7 Millionen Aufrufe verzeichneten.
Leichte Sprache hingegen wendet sich spezifisch an Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, schweren Leseschwierigkeiten oder komplexen Lernbehinderungen. Diese Präzision in der Zielgruppenadressierung erfordert einen wissenschaftlich fundierten Ansatz, der sich in der Entwicklung eigener Qualitätsstandards niederschlägt. Das capito-Netzwerk arbeitet mit einem TÜV-zertifizierten Verfahren und verpflichtenden Prüfgruppen, die ausschließlich aus Vertretern der Zielgruppe bestehen.
Rechtliche Rahmenbedingungen in Österreich
Die rechtliche Landschaft Österreichs schafft klare Vorgaben für den Einsatz verständlicher Sprache. Das Web-Zugänglichkeits-Gesetz verpflichtet öffentliche Stellen des Bundes seit 2019 zur barrierefreien Gestaltung ihrer digitalen Angebote. Diese Verpflichtung umfasst explizit die Verständlichkeit von Inhalten, was sowohl Einfache als auch Leichte Sprache betrifft. Das Bundeskanzleramt führt als grundlegende Prinzipien Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit auf.
Das seit Juni 2025 geltende Barrierefreiheitsgesetz erweitert diese Verpflichtungen auf private Unternehmen, die bestimmte Produkte und Dienstleistungen anbieten. Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern müssen sicherstellen, dass ihre E-Commerce-Plattformen, Online-Banking-Services und digitalen Serviceangebote barrierefrei zugänglich sind. Dies schließt die sprachliche Zugänglichkeit mit ein und macht verständliche Kommunikation zu einem Wettbewerbsfaktor.
Praktische Umsetzungsstrategien
Die praktische Umsetzung verständlicher Sprache erfordert unterschiedliche Strategien. Einfache Sprache kann direkt in bestehende Webseitenstrukturen integriert werden und erfordert primär redaktionelle Überarbeitung ohne grundlegende technische Änderungen. Die Wirtschaftskammer Österreich weist darauf hin, dass bereits geringfügige Verbesserungen zur Barrierefreiheit die rechtliche Situation von Unternehmen verbessern können, auch wenn eine vollständige Barrierefreiheit nicht sofort realisierbar ist.
Leichte Sprache hingegen erfordert oft eigene Bereiche oder separate Websites, da ihre stark vereinfachte Struktur nicht in konventionelle Webseitendesigns integriert werden kann. Die visuellen Anforderungen unterscheiden sich ebenfalls fundamental: Während Einfache Sprache mit normalen Layouts funktioniert und von klarer Strukturierung profitiert, benötigt Leichte Sprache größere Schriftarten, mehr Weißraum, konkrete Bilder zur Textunterstützung und eine sehr übersichtliche Navigation.
Die Rolle der Bilder in der visuellen Kommunikation
Ein besonders bedeutsamer Aspekt ist die unterschiedliche Rolle von Bildern in beiden Konzepten. In der Einfachen Sprache unterstützen Bilder den Text, ohne zwingend notwendig zu sein. Sie folgen den üblichen Regeln der Webgestaltung und können durchaus metaphorischen Charakter haben. In der Leichten Sprache sind Bilder essentiell für das Verständnis. Sie müssen konkret sein, dürfen keine Metaphern verwenden und müssen direkt zum Text passen. Das capito-Konzept betont, dass ein Foto von einem echten Amt hilfreicher ist als ein abstraktes Behördensymbol, ein Bild von schüttelnden Händen verständlicher als das abstrakte Wort „Vereinbarung“.
Diese Bildsprache erfordert nicht nur gestalterisches, sondern auch pädagogisches Verständnis. Die Entwicklung geeigneter Bildkonzepte stellt eine eigene Disziplin dar, die in der österreichischen Praxis durch spezialisierte Organisationen wie WIBS oder die Lebenshilfe Österreich professionell umgesetzt wird.
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Implikationen
Die wirtschaftlichen Auswirkungen verständlicher Sprache gehen weit über Compliance-Anforderungen hinaus. Capito weist darauf hin, dass Arbeitsunfälle durchschnittlich 3000 Euro kosten und durch leicht verständliche Sicherheitshinweise reduziert werden können. Diese Erkenntnis macht deutlich, dass verständliche Kommunikation nicht nur soziale Verantwortung, sondern auch wirtschaftliche Rationalität darstellt.
Für österreichische Unternehmen eröffnet die Spezialisierung auf verständliche Kommunikation neue Geschäftsfelder. Der Domus Verlag in Wien berichtet von vermehrten Anfragen aus der Wirtschaft nach „effizienter Kundenkommunikation“. Banken und Versicherungen erkennen zunehmend, dass verständliche Sprache nicht nur rechtliche Sicherheit bietet, sondern auch die Kundenzufriedenheit steigert und Beschwerden reduziert.
Technologische Entwicklungen und KI-Unterstützung
Die Entwicklung von KI-Tools wie capito.ai revolutioniert die Erstellung verständlicher Texte. Diese automatisierten Übersetzungswerkzeuge können komplexe Texte schnell und kostengünstig in verschiedene Verständlichkeitsstufen übersetzen. Allerdings betont die Fachwelt, dass menschliche Expertise durch technische Lösungen nicht vollständig ersetzt werden kann, insbesondere bei der Leichten Sprache, wo die verpflichtende Prüfung durch Zielgruppenvertreter einen unverzichtbaren Qualitätsstandard darstellt.
Diese technologischen Entwicklungen machen verständliche Kommunikation für kleinere Organisationen zunehmend zugänglich. Gleichzeitig steigen die Qualitätsansprüche, da automatisierte Werkzeuge eine Grundversorgung sicherstellen, während spezialisierte Anbieter sich auf komplexere Anwendungen fokussieren müssen.
Qualitätssicherung und Zertifizierung
Ein zentraler Unterschied zwischen beiden Konzepten liegt in den Qualitätssicherungsverfahren. Während für Einfache Sprache bis vor kurzem keine einheitlichen Standards existierten, arbeitet die Branche heute mit ISO- und DIN-Normen. Das capito-Netzwerk hat von Beginn an regelbasiert gearbeitet und entwickelt seinen Kriterienkatalog mit rund 90 Kriterien kontinuierlich durch wissenschaftliche Forschung und praktische Erfahrung weiter.
Für Leichte Sprache sind die Qualitätsanforderungen noch strenger. Jeder Text muss von der Zielgruppe selbst geprüft werden. Diese Prüfgruppen bestehen aus Menschen mit Lernschwierigkeiten, die als Experten in eigener Sache fungieren und für ihre Arbeit bezahlt werden. Diese Wertschätzung der Zielgruppenexpertise stellt einen wichtigen Aspekt der partizipativen Entwicklung dar. In Österreich bieten Organisationen wie die Lebenshilfe Österreich und capito Wien solche Prüfdienstleistungen an.
Herausforderungen und häufige Fehler
Ein häufiger Fehler in der Praxis ist die Verwechslung beider Konzepte. Einfache Sprache, die zu stark verkürzt wird, kann wichtige Informationen verlieren und damit ihre Funktion als präzise Kommunikation verfehlen. Umgekehrt verfehlt Leichte Sprache, die nicht konsequent genug umgesetzt wird, ihre spezifische Zielgruppe und wird zu einem unbrauchbaren Hybrid ohne klare Adressierung.
Die österreichische Praxis zeigt, dass erfolgreiche Implementierung ein tiefes Verständnis für die jeweiligen Regeln und Zielgruppen erfordert. Die Donau-Universität Krems war bereits in den 1990er Jahren an Versuchen beteiligt, das Sozialversicherungsgesetz in verständlichere Form zu bringen, was zeigt, dass das Bewusstsein für die Problematik bereits lange existiert, die systematische Umsetzung aber Zeit benötigt.
Zukunftsperspektiven und internationale Entwicklungen
Die Zukunft verständlicher Kommunikation liegt in der Koexistenz beider Ansätze. Große Organisationen entwickeln zunehmend mehrsprachige Strategien mit Standardsprache für Fachpublikum, Einfacher Sprache für die breite Öffentlichkeit und Leichter Sprache für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Das internationale capito-Projekt im Rahmen von ERASMUS+ entwickelt diese Konzepte für Englisch, Französisch und Italienisch weiter und zeigt, dass verständliche Kommunikation ein europaweites Anliegen darstellt.
Für österreichische Unternehmen und Institutionen bedeutet dies die Notwendigkeit strategischer Planung. Die Entscheidung zwischen Einfacher Sprache und Leichter Sprache ist letztendlich eine Entscheidung über Zielgruppen, Qualitätsansprüche und verfügbare Ressourcen. Das österreichische Parlament zeigt exemplarisch, wie eine gestufte Herangehensweise beiden Anforderungen gerecht werden kann.
Gesellschaftliche Transformation durch sprachliche Inklusion
Die gesellschaftliche Wirkung beider Sprachformen ist beträchtlich und geht über individuelle Kommunikationsbedürfnisse hinaus. Einfache Sprache demokratisiert Informationen und macht komplexe Sachverhalte für mehr Menschen zugänglich. Sie trägt zur politischen Partizipation bei, indem sie Bürgern ermöglicht, informierte Entscheidungen zu treffen. Leichte Sprache hingegen ermöglicht Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen erstmals echte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und macht aus passiven Betreuungsempfängern aktive Bürger.
Diese Transformation wird durch die österreichische Gesetzgebung unterstützt und beschleunigt. Die Verpflichtung zur sprachlichen Barrierefreiheit schafft nicht nur rechtliche Sicherheit, sondern auch gesellschaftliche Sensibilisierung. Organisationen, die proaktiv auf verständliche Kommunikation setzen, positionieren sich als inklusive und zukunftsorientierte Akteure.
Fazit: Brücken statt Barrieren
Die Entwicklung verständlicher Kommunikation in Österreich steht an einem Wendepunkt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind geschaffen, die technischen Möglichkeiten erweitern sich kontinuierlich, und das gesellschaftliche Bewusstsein wächst. Beide Konzepte – Einfache und Leichte Sprache – haben ihre spezifische Berechtigung und ergänzen sich in einer umfassenden Kommunikationsstrategie.
Die Herausforderung liegt nicht in der Entscheidung zwischen beiden Ansätzen, sondern in ihrer kompetenten und zielgruppengerechten Anwendung. Verständliche Kommunikation ist weder eine technische Nebensache noch eine soziale Geste, sondern ein strategisches Instrument für erfolgreiche, inklusive und rechtskonforme Kommunikation in der digitalen Gesellschaft.
In einer Zeit, in der Informationen zunehmend über digitale Kanäle vermittelt werden, entscheidet die Wahl der Sprache darüber, wer teilhaben kann und wer ausgeschlossen bleibt. Die österreichische Entwicklung zeigt: Wenn Worte Brücken bauen sollen, müssen sie bewusst und kompetent eingesetzt werden. Die rechtlichen, technischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür sind in Österreich vorhanden – jetzt gilt es, sie konsequent zu nutzen.