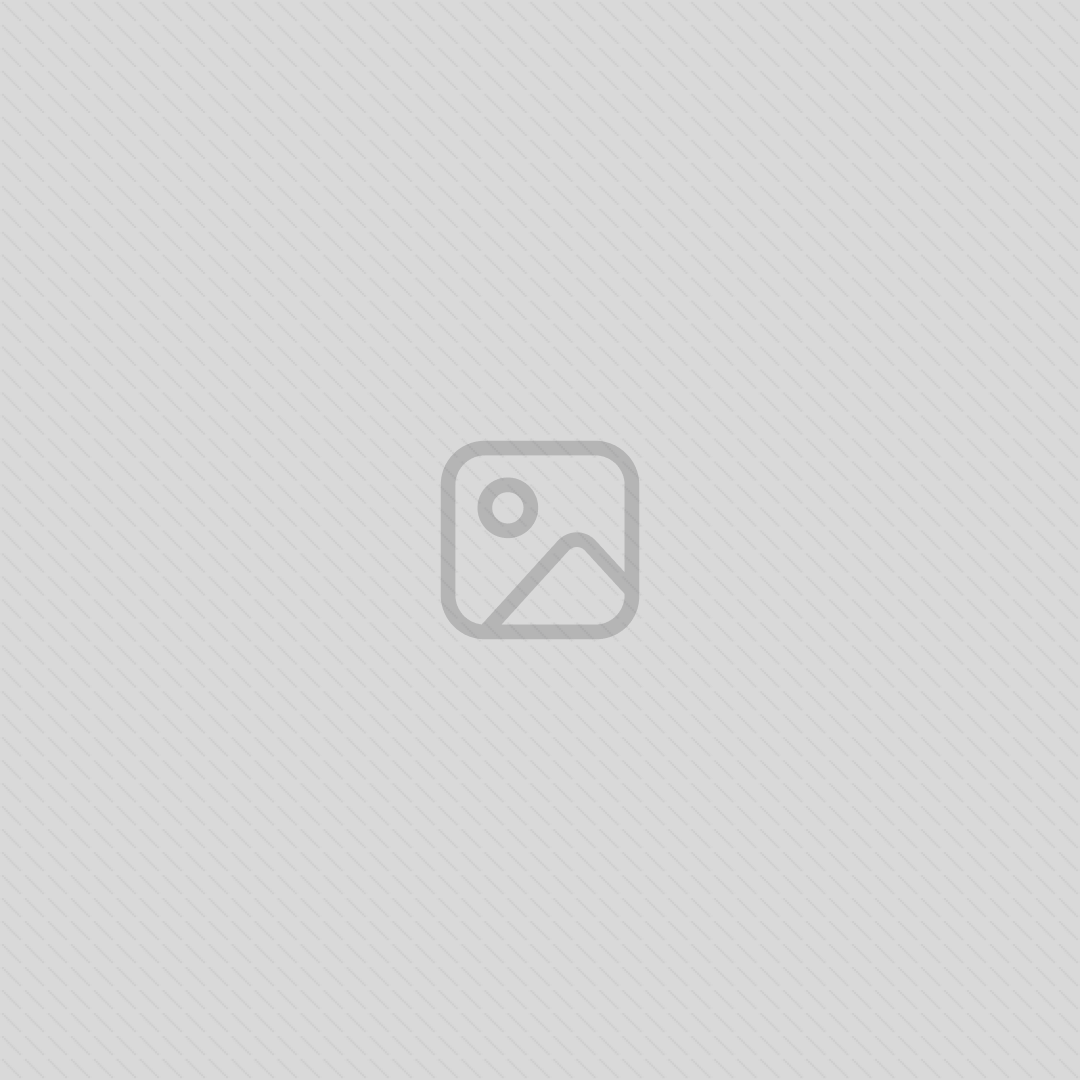Europäische Standards als Grundlage
Die digitale Barrierefreiheit in Österreich basiert auf einem europäischen Rahmenwerk, das einheitliche Standards für alle EU-Mitgliedstaaten schafft. Der European Accessibility Act (EAA) von 2019 hat dabei den Grundstein für eine harmonisierte Herangehensweise gelegt, die sowohl Rechtssicherheit als auch Planbarkeit für Unternehmen bietet (Parlament Österreich, 2023).
Diese europäische Richtlinie wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass bestimmte Produkte und Dienstleistungen, die für Menschen mit Behinderungen als besonders wichtig eingestuft wurden, europaweit den gleichen Barrierefreiheitsanforderungen entsprechen. Dabei geht es nicht nur um die Produkte selbst, sondern auch darum, dass Menschen mit Behinderungen diese Produkte und Dienstleistungen problemlos online erwerben oder nutzen können.
Das österreichische Barrierefreiheitsgesetz (BaFG)
Mit dem Barrierefreiheitsgesetz (BaFG), das am 28. Juni 2025 in Kraft tritt, setzt Österreich die europäische Richtlinie in nationales Recht um (WKO, 2024)². Das Gesetz schafft klare Rahmenbedingungen für digitale Barrierefreiheit und orientiert sich dabei an international anerkannten Standards.
Anwendungsbereich und betroffene Bereiche
Das BaFG umfasst verschiedene Bereiche der digitalen Kommunikation und des elektronischen Geschäftsverkehrs. Betroffen sind insbesondere:
- E-Commerce-Plattformen und Online-Shops
- Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr wie Online-Banking und E-Payment-Systeme
- Buchungsplattformen für Verkehr, Hotels und Events
- Kommunikationsdienste einschließlich Messenger-Dienste und VoIP-Anwendungen
- E-Book-Plattformen und digitale Medieninhalte
Dabei liegt der Fokus auf Dienstleistungen, die über Websites oder mobile Anwendungen erbracht werden und eine besondere Relevanz für die gesellschaftliche Teilhabe haben (Earlybird, 2024).
Unternehmensgröße und Ausnahmeregelungen
Das Gesetz berücksichtigt unterschiedliche Unternehmensgrößen und sieht entsprechende Regelungen vor:
Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von maximal 2 Millionen Euro sind grundsätzlich vom Anwendungsbereich ausgenommen. Diese Regelung trägt den besonderen Herausforderungen kleinerer Betriebe Rechnung (Barrierefrei.at, 2024).
Für größere Unternehmen besteht die Möglichkeit, eine unverhältnismäßige Belastung geltend zu machen, wenn die Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen zu einer übermäßigen organisatorischen oder finanziellen Belastung führen würde. Diese Ausnahme muss jedoch dokumentiert und alle fünf Jahre neu bewertet werden.
Übergangsfristen und gestaffelter Ansatz
Das Gesetz sieht einen gestaffelten Implementierungsansatz vor, der Unternehmen ausreichend Zeit zur Anpassung gibt:
Neue digitale Produkte und Dienstleistungen müssen ab dem 28. Juni 2025 den Barrierefreiheitsanforderungen entsprechen. Bestehende Angebote haben eine Übergangsfrist bis zum 28. Juni 2030, um vollständig angepasst zu werden (WESEO, 2024).
Dienstleistungserbringende können ihre Services bis zum 27. Juni 2030 weiterhin unter Einsatz von Produkten erbringen, die bereits vor dem Stichtag rechtmäßig eingesetzt wurden. Diese Regelung schafft Planungssicherheit und ermöglicht eine schrittweise Modernisierung der digitalen Infrastruktur.
Technische Standards und Umsetzung
Als technische Grundlage dienen die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 auf Level AA, die international als Standard für barrierefreie Webinhalte anerkannt sind (Digitale Barrierefreiheit Österreich, 2025)⁶. Diese Richtlinien bieten konkrete, testbare Kriterien für die Umsetzung barrierefreier digitaler Angebote.
Die Orientierung an diesen etablierten Standards gewährleistet, dass österreichische Unternehmen nicht nur den nationalen Anforderungen entsprechen, sondern auch international anschlussfähige Lösungen entwickeln. Gleichzeitig profitieren sie von der umfangreichen Dokumentation und den verfügbaren Hilfestellungen, die zu diesen Standards existieren.
Unterstützung und Förderungen
Die österreichische Regierung hat erkannt, dass die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit Unterstützung benötigt. Daher steht mit der Initiative „Barriere:freie Unternehmen“ eine Förderung des Sozialministeriums zur Verfügung, die Unternehmen bei der WCAG-konformen Gestaltung ihrer Websites unterstützt. Diese kann als einmaliger Kostenzuschuss in Höhe von 25% der Investitionskosten, maximal jedoch 2.500 Euro pro Unternehmen, beantragt werden (WESEO, 2024).
Monitoring und Unterstützungssysteme
Für die Überwachung und Unterstützung der Umsetzung wurde das Sozialministeriumservice als zuständige Behörde bestimmt. Diese Stelle fungiert nicht nur als Kontrollorgan, sondern auch als Ansprechpartner für Fragen zur Umsetzung und bietet Orientierungshilfen für betroffene Unternehmen.
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Interessensvertretungen wie der Österreichische Behindertenrat, die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer haben die Möglichkeit, sich niederschwellig an das Sozialministeriumservice zu wenden, um auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen (Parlament Österreich, 2023).
Parallele Entwicklungen im öffentlichen Sektor
Ergänzend zum BaFG ist bereits seit 2018 das Web-Zugänglichkeits-Gesetz (WZG) für öffentliche Stellen in Kraft. Dieses Gesetz verpflichtet Bundesbehörden und überwiegend öffentlich finanzierte Einrichtungen zur barrierefreien Gestaltung ihrer digitalen Angebote und schafft damit Referenzfälle für die Umsetzung in der Praxis (Earlybird, 2024).
Die Erfahrungen aus dem öffentlichen Sektor zeigen, dass die Implementierung barrierefreier Standards durchaus bewältigbar ist und gleichzeitig zu qualitativen Verbesserungen der digitalen Angebote führt.
Internationale Einbettung
Österreich folgt mit diesen Regelungen einem internationalen Trend. Ähnliche Gesetze existieren bereits in verschiedenen Ländern und Regionen weltweit. Diese Harmonisierung erleichtert es international tätigen Unternehmen, einheitliche Standards zu implementieren, anstatt für jeden Markt separate Lösungen entwickeln zu müssen.
Praktische Schritte zur Vorbereitung
Für Unternehmen, die von den neuen Regelungen betroffen sind, empfiehlt sich eine strukturierte Herangehensweise:
Analyse des Status quo: Eine Bewertung der aktuellen digitalen Angebote hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit schafft Klarheit über den Handlungsbedarf.
Priorisierung: Die schrittweise Umsetzung beginnend mit den wichtigsten Angeboten ermöglicht eine planvolle Herangehensweise.
Schulung der Mitarbeiter: Die Integration von Barrierefreiheit in bestehende Workflows erfordert entsprechende Kenntnisse im Team.
Externe Expertise: Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern kann den Implementierungsprozess beschleunigen und die Qualität der Umsetzung sicherstellen.
Fazit: Rechtssicherheit durch klare Standards
Das österreichische Barrierefreiheitsgesetz schafft einen klaren rechtlichen Rahmen für digitale Inklusion. Durch die Orientierung an etablierten internationalen Standards, angemessene Übergangsfristen und Unterstützungsangebote wird ein ausgewogener Ansatz verfolgt, der sowohl den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen als auch den praktischen Herausforderungen von Unternehmen Rechnung trägt.
Die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit wird damit von einer Ungewissheit zu einer planvollen Aufgabe mit klaren Zielvorgaben und verfügbaren Hilfestellungen. Unternehmen, die sich frühzeitig mit diesen Anforderungen auseinandersetzen, profitieren von einem strukturierten Implementierungsprozess und können die Vorteile barrierefreier digitaler Angebote optimal nutzen.